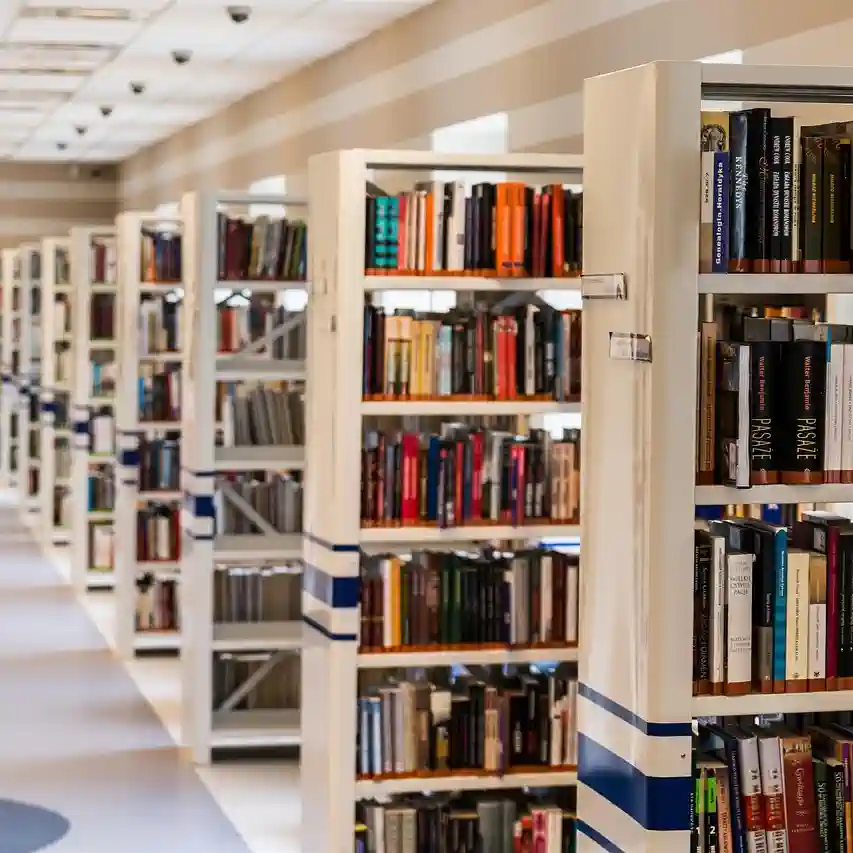Informationsquelle Wikipedia
Seit mehreren Jahren liegen „Bettelbriefe“ von Wikipedia in der (physischen) Post. Diesjähriger Tenor: Das meiste von KI-Tools verwertete Wissen stamme aus Wikipedia. Deshalb sei es so wichtig. Dort gäbe es eine „gesicherte Wissensbasis“. Ist das wirklich so?
Ich habe in der Vergangenheit des öfteren für Wikipedia gespendet. Der Wunsch einer Spendenbescheinigung erforderte die Preisgabe meiner Adressdaten. Seither werde ich mit Papier gespamt. Was mich in keiner Weise zum Spenden motiviert. Darüber nachgedacht habe ich schon länger: Von mir gibt es kein Geld mehr. Die Gründe hat mir das letzte Schreiben geliefert.Wir erinnern uns an den elften Namen von Herrn zu Guttenberg. Wikipedia entpuppte sich als Fake-Schleuder. Ein Spaßvogel hatte, wohl wissend, wie neuzeitliche journalistische Recherche funktioniert, einen »Wilhelm« in die beachtliche Namensliste des frisch gekürten Wirtschaftsministers geschmuggelt.
Wikipedia-Kenner werden einwenden, es hätte bemerkt werden können, wären die Zitierenden in die „Versionsgeschichte“ eingetaucht. Dort könnten Änderungen verfolgt und Manipulationen entdeckt werden. Unklar bleibt, woran geneigte Lesende die Wahrheit erkennen sollen: War es vorher oder ist es jetzt richtig? Es ist völlig unklar, woher und von wem die angezeigte Information stammt. Wie kompetent die Erstellenden sind, welche Reputation sie haben, die das jeweils aktuell Angezeigte zur „gesicherten Wissensbasis“ machen sollen, bleibt im Dunkeln.
Konzeptionell kann jeder Dödel einen Beitrag bei Wikipedia verfassen oder einen bestehenden ändern (s.o.). Ob das völliger Käse oder fundiert ist, entscheiden „Moderatoren“, die für die Qualität sorgen sollen. Wobei deren thematische Kompetenzen ebenfalls völlig unklar sind. Sie bilden sich primär aus der Beteiligungsmenge. Anteil an dieser Menge hat das Löschen von Beiträgen und Ergänzungen anderer. Aus persönlicher Erfahrung können Löschungen so schnell erfolgen, dass eine gerade eingefügte Änderung bereits beim Aktualisieren der Seite schon verworfen ist. Was je nach ergänztem Textumfang eine rekordverdächtige Lesekompetenz voraussetzt. Zusätzlich begnadete Recherche-Fähigkeiten für den Faktencheck, der diese Entscheidung begründen könnte.
An einigen Stellen war mein Wissen „aus erster Hand“, was den löschenden Moderator als unwissenden, aber mächtigeren „Wissenspfleger“ auswies. Aus profanen Gründen ist mir unbekannt, ob das noch übliche Praxis ist: Meinerseits gibt es deshalb keine Mitarbeit an der „gesicherten Wissensbasis“ mehr.
Im Grunde muss alles bei Wikipedia mit großen Fragezeichen versehen sein. Als „belastbare Quelle“ taugt es kaum, wenn die Qualifikation der Schreibenden darin besteht, dass sie es halt tun. Mit dem Zitieren von Quellen aus dem Internet das Geschriebene untermauern, ist genau genommen „Hörensagen“. Womöglich bezieht der verwiesene Artikel seine Information sogar aus der Quelle, die ihn referenziert.
Das im Bettelbrief beschworene „solide Fundament“ von Wikipedia ist nach wissenschaftlichen Maßstäben ein Sandhaufen. Wie solide Information in einem Artikel ist, bleibt das Geheimnis der Autoren. Woher die ihr Wissen beziehen, muss keiner belegen. Es wird von niemandem qualifiziert abgefragt. Wikipedia setzt schlicht darauf, dass Fehler von Lesenden bemerkt und korrigiert werden. Was keine Gewähr für „korrekt“ ist.
Das Wikipedia-Konzept mag „überwiegend“ funktionieren. Wer belastbare Information will, sollte sie dennoch keinesfalls von einer KI produzieren lassen, die von Haus aus Wissenslücken kreativ füllen. Davon abgesehen können sie nur auf Information zurück greifen, die irgendwer irgendwo ins Netz gestellt hat. Ohne zu wissen, ob das so stimmt. Allein die Anzahl gleicher Information ist kein Maßstab: Wer welchen Fehler bei wem abschreibt und veröffentlicht, schreibt niemand an seinen Artikel dran. Es bläht lediglich die Datenbasis auf. Weshalb der Eindruck der Richtigkeit entsteht, die sich bei professioneller, qualifizierter Recherche als grober Unfug herausstellen kann. Wovor Wikipedia ebensowenig gefeit ist. Siehe oben.
Das Bild stammt von Pixabay.